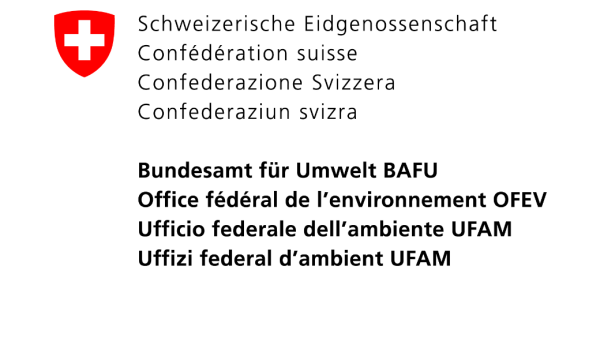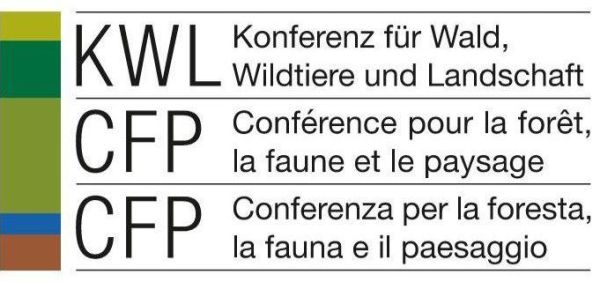Feuer und Erde
Lignum Terra
Projektbeschrieb
Mittels Recherchen und Untersuchungen werden die Eigenschaften von Beplankungen und Bekleidungen aus Lehmbaustoffen brandschutztechnisch eingeordnet. Dadurch können die Experten aus Lehmbau, Holzbau und Brandschutz gemeinsam Bedürfnisse abstecken. So werden zielführende Brandversuche von Holzkonstruktionen mit Lehm aufgegleist, durchgeführt, ausgewertet und mit weiteren Beiträgen abgeglichen.
À travers des recherches et des investigations, les propriétés des revêtements et habillages en matériaux en terre sont classées en termes de protection incendie. Cela permet aux experts en construction en terre crue, en construction bois et en protection incendie de définir ensemble leurs besoins. Ainsi, des essais incendie ciblés sur des structures en bois avec de la terre crue sont planifiés, réalisés, analysés et comparés à d'autres contributions.
Projektresultate
Ein grundlegendes Verständnis für das Verhalten flächiger Lehmbaustoffe als Brandschutz in gängigen Konstruktionen mit Schweizer Rahmenbedingungen wird erreicht und durch Definition der Anforderungen und Berechnungswerte belegt. Damit ermöglichen sie die Integration von Lehm in die Lignum-Publikation 2026 zum Brandschutz und verbreitern das Spektrum nachhaltiger Baustoffkombinationen im Holzbau.
Une compréhension fondamentale du comportement des matériaux de construction plats en terre crue en tant que protection incendie dans les constructions courantes, dans le cadre des normes suisses, est atteinte et prouvé par la définition des exigences et des valeurs de calcul. Cela permet d’intégrer la terre crue dans la publication Lignum 2026 sur la protection incendie et d’élargir le spectre des combinaisons de matériaux durables en construction bois.

Projektteam:
- Christiane Löffler, Architektin, chloe architektur
- Ivan Brühwiler, Holzbau- und Brandschutzingenieur, B3 Ingenieure AG
- Adrian Baumberger, Architekt, baubüro insitu AG
- Andrea Frangi, Professor IBK, Holzbauingenieur, ETH Zürich
- Simon Rubin, Holzbau- und Brandschutzingenieur, Lauber Ingenieure AG
- Christoph Angehrn, Holzbau- und Brandschutzingenieur, Atlas Tragwerke AG
- Bernhard Furrer, Holzbauingenieur, Lignum Holzwirtschaft Schweiz
- Stephan Eicher, Architekt, Stephan Eicher Architekten SIA BSA GmbH
- Johanna Liblik, Bauingenieurin, TalTech (Estland)
- Alar Just, Professor Structural Engineering, Bauingenieur, TalTech (Estland)
Wir bedanken uns herzlich bei unseren öffentlichen Förderern
Herzlichen Dank
vor allem der breiten Unterstützung vieler lehminteressierter Akteure aus der Holz- und Lehhmbaubranche und der Bauwirtschaft, sowie den unterstützenden IG Lehm-Mitgliedern
- Allreal Generalunternehmung AG
- Timbatec Holzbauingenieure Schweiz AG
- THERMOTEC Systemtechnik AG
- Gipsergeschäft Kradolfer GmbH
- Weisser Lehmbau und Baumeisterarbeiten Sami Weisser
- Marco Ramaioli, baubiologische Architektur & Handwerk
- Lehmwerk ch
- S. Müller Holzbau AG
- Vogelsanger Stuckaturhandwerk
- A.L.T.-Bau
- Terrafresko
- stroba naturbaustoffe ag
- PIRMIN JUNG Schweiz AG
- ECO-BIO-LOGO
- Sprecher · Schneider Architektur AG
- Hart KERAMIK AG
- Adrian Pfäffli
- Beer Holzbau AG
- Blumer-Lehmann AG
- Baumann Lukas Architektur AG
- Hauser Ofenbau GmbH
- Wildholz Bau GmbH
- Strüby Unternehmungen
- B3 Ingenieure AG
- baubüro in situ ag
- Lehmbaustoffe Schleusner & Söhne GmbH
- Makiol Wiederkehr AG
- Marc Hänni Architekten GmbH
- WMM Ingenieure AG
- Schönauer AG
sowie viele Weitere, die uns still und vertrauensvoll mittragen.

Lignum Terra
Grundlagen
Ausgangslage / Problembeschreibung
Hybride Konstruktionen aus Holz und Lehm haben eine lange Tradition. Die Kombination von Holz und Lehm ist heute aber vielfach durch Auflagen im Brandschutz behindert und der Baustoff Lehm als gleichwertiger Baustoff zu anderen mineralischen Baustoffen – insbesondere in Regelwerken – nicht vorhanden. Allerdings ist auch das Bewusstsein für Baustoffkreisläufe, Energiebilanzen und Emissionen im Zusammenhang mit der Erstellung von Gebäuden gestiegen. Dies birgt enorme Chancen sowohl für eine Weiterentwicklung im Bauen mit Holz als auch für die Verbreitung von Lehmbau. So ist es in einer gestiegenen Nachfrage nach dem Wissen zum Lehmbau und Interesse am Bauen mit Lehm und nachwachsenden Baumaterialien spürbar. Allerdings ist diese Entwicklung im heutigen Planungs- und Bauwesen noch nicht ablesbar und die begünstigenden Rahmenbedingungen dazu müssen erst entwickelt werden.
Der Einsatz von Lehmbaustoffen kann Baustoffe ersetzen, die begrenzter verfügbar und energieintensiver in der Herstellung sind und damit mehr CO2 ausstossen. Dadurch kann die Umwelt entlastet werden. Gleichzeitig kann Erdaushub, der deponiert werden müsste, verwertet werden und der intrinsisch kreislauffähige Baustoff Lehm mit seiner natürlichen Zusammensetzung unendlich oft gleichwertig wiederverwertet werden. Sofern eine weitere Verwendung des Lehms nicht mehr erwünscht sein sollte, könnte er auch umweltverträglich in die Natur zurückgeführt werden. Über klimaregulierende Eigenschaften des Lehms und dadurch reduziertem technischem Aufwand wird die Umwelt über sich wandelnde Anforderungen zudem weiter entlastet. Insbesondere aber profitiert die Gesundheit der Nutzenden von den Eigenschaften des Lehms, der Schadstoffe und Gerüche absorbiert und abbaut, Raumluftfeuchtigkeit in einem behaglichen und gesundheitsfördernden Bereich hält und Schallwellen dämpft.
In Europa und der Schweiz gibt es derzeit kein zeitgemässes Regelwerk im Brandschutz, das Lehm berücksichtigt. Lehm kommt heute weder in den Regelwerken des SIA noch der VKF vor, da er als Baustoff lange Zeit nicht geschätzt wurde und durch die Industrialisierung mit günstiger fossiler Energie und entsprechenden Materialien verdrängt wurde. Dieses Ungleichgewicht sollte in Zeiten des Klimawandels dringend korrigiert werden und jenseits von Anerkennungsprozessen einzelner Produkte ein allgemeines Regelwerk entstehen.
Lehmbaustoffe haben grosses Potenzial, als Schichten und Bauteile brandschutztechnisch wirksam eingesetzt zu werden. Sowohl Prüfungen von Massivlehmbauteilen wie Lehmsteinen [1] und Stampflehm [2] deuten darauf hin. Auch Forschungen zu Lehmputz [3] belegen dies.
Vor dem Hintergrund der in den letzten Jahrzehnten weiter entwickelten Brandschutzvorschriften, insbesondere rund um den Holzbau, sollen indes auch flächige Lehmbaustoffe im Holzbau breite Anerkennung finden und relativ einfach mit herkömmlichen Leichtbaukonstruktionen umgesetzt werden können. So können Verarbeitungen mit Lehmbaustoffen von konventionellem Leichtbau mit Platten abgeleitet werden, verschiedene Lehmplatten sind im Handel bereits erhältlich und Lehm ist als Putz bewährt.
Als Grundlage können hierbei Produktnormen wie die DIN zu Lehmbaustoffen (insbes. DIN 18947:2018-12 zu Lehmputzmörtel und DIN 18948:2018-12 zu Lehmplatten) dienen. Wegbereitend ist jedoch die Forschungsarbeit von Johanna Liblik an der Tallinn University of Technology “Performance of timber structures protected by traditional plaster systems in fire”
Aufgrund der Innovationskraft und der Stärken im Schweizer Holzbau wird in diesem Projekt auf Lehmputze und Lehmplatten fokussiert, während in anderen Projekten und in Nachbarländern derzeit mehr zu Massivlehmbau geforscht wird. Im Bereich von massiven Konstruktionen mit Holz und Lehm ist das Innosuisse-Projekt Regeneratives Bauen “Think Earth” aktiv, an dem Forschungs- und Wirtschaftspartner einschliesslich der IG Lehm und der Lignum beteiligt sind.
Das Spektrum der bisher geprüften Lehmputze und Lehmplatten entspricht allerdings auch nur teilweise dem hiesigen Angebot, das sich zudem weiterentwickeln kann. Die Auswertungen sind noch recht konservativ gehalten und auf internationaler Ebene gibt es Hinweise auf günstigere Entwicklungen. Ein Transfer aktueller und laufender Forschungen im Lehmbau in den Schweizer Kontext ist zudem notwendig, um die Rahmenbedingungen im Lehmbau, die eine direkte Umsetzbarkeit und Einbettung in hiesige Anforderungsprofile erlauben, schaffen zu können. Dazu gehört insbesondere die Grundlagenermittlung von Berechnungswerten im Brandschutz.
Es gibt einige Nachweise zu Feuerwiderständen über Brandversuche dieser Produktgruppen, die von Herstellern oder Händlern erbracht wurden und aufgrund zu spezifischer Eingrenzung keine breite Anwendung finden. Als Baustein eines Stand der Technik-Papiers zu Lehmbau sollte sich eine breite Einsatzmöglichkeit im Hochbau unabhängig von herstellerspezifischen Bauteilaufbauten und produktspezifischen Parametern eröffnen. Damit kann sie zur Grundlage und zum Anstoss für weitere, vertiefende Forschung werden und eine neue Dynamik auslösen.
Um wieder Vertrauen in das Material zu schaffen, damit Planende, Investoren und Institutionen es einsetzen und es interessant für Händler und Hersteller wird, ist ein Beitrag zur Wissenserarbeitung für ein gutes Planungsinstrument und eine grundlegende Dokumentation im Lehmbau wichtig. Auch die dringende Erweiterung des Betrachtungshorizonts auf gesundheitliche Aspekte, dessen Überlagerung mit Bauphysik oder Low-Tech eröffnet sich damit. Indirekt profitiert also die breite Bevölkerung, die ein steigendes Interesse an Nachhaltigkeit äussert, von diesem Wandel zu zukunftsfähigem Bauen.
Als zielführend für eine breite Anwendung wird die Integration von Lehmbaustoffen in die Lignum-Dokumentation Brandschutz erachtet, welches ein praktisches Planungswerkzeug im Holzbau darstellt. Damit dient das lehmbezogene Vertiefungsprojekt automatisch Planern und Handwerkern im Holzbau und Lehmbau. Die IG Lehm als breiter und praxisbezogener Fachverband steht für eine naheliegende, unmittelbare Umsetzung und für den Verbund der Erfahrung praktizierender Lehmbauer.
Projektziele und Projektbeschreibung
Projektziele
Lehm ergänzt den Holzbau komplementär und kann in dieser Kombination neue Impulse im nachhaltigen, kreislauforientierten Bauwesen auslösen. Wenn Holz effizient dort zum Einsatz kommt, wo es sinnvoll ist, kann es durch andere Baumaterialien unterstützt werden und andersartig seine Qualitäten zeigen. Mit seiner Rezyklierbarkeit steht der formbare Lehm der Anpassungsfähigkeit, den Wiederverwendungsmöglichkeiten und der Langlebigkeit von Holzkonstruktionen im Um- und Neubau immer wieder neu zur Seite und vermeidet damit unnötige Entsorgung, Baustoffe mit problematischen Reststoffen und Deponieflächen, sowie die damit verbundenen Kosten.
Die Materialien Holz und Lehm ergänzen sich sehr gut und entfalten eine ganzheitliche Wirkung. Sie ergeben zusammen bewährte ökologische Mischbauweisen und können ihren Stärken entsprechend nachhaltig eingesetzt werden. Gleichzeitig führen bekannte Holzkonstruktionsweisen durch Lehmbaustoffe als brandschutztechnisch wirksame Schichten oder das Einbringen von nicht brennbarer Masse in Form von Lehmbaustoffen zu einer besseren Bilanz der Grauen Energie und geringem CO2-Emmissionen der Gebäude insgesamt. Darüber hinaus können die bauphysikalischen Vorteile zu einer weniger komplizierten Haustechnik und zu einer gesundheitsfördernden gebauten Umwelt beitragen.
Die Palette der Anwendungen reicht von Lehm in Form von Putzen und Platten, bis zu Lehmschüttungen, Unterlagsböden aus Lehm und Massivbauteilen wie etwa Lehmsteine als Ausfachungen oder zur Beschwerung. Lehmbaustoffe können rein mineralisch sein oder auch pflanzliche Fasern enthalten. Die Erweiterungen hinsichtlich der Verwendung von Aushublehm von Baustellen ist hierbei ein langfristiges, ökologisches Ziel, welches vorerst zugunsten vorhandener Produkte zurückstehen muss. Weitere Potenziale dazu sollten geprüft werden.
Die Lignum, der Dachverband der Schweizer Holzwirtschaft, erarbeitet bis Ende 2026 im Rahmen des «Aktionsplan Holz» und im Einklang mit den in der Überarbeitung befindlichen VKF-Brandschutzvorschriften 2026 eine Revision der «Lignum-Dokumentation Brandschutz». Dabei steht auch der Materialkanon zur Disposition und könnte im Sinne einer zukunftsorientierten Transformation in der Bauwirtschaft neu auch Lehmbaustoffe aufnehmen. Dies betrifft in erster Linie die Lignum-Publikation 4.1 Bauteile in Holz – Decken, Wände und Bekleidungen mit Feuerwiderstand. Mit entsprechenden Belegen zu den noch nicht vertrauten Lehmbaustoffen muss eine ausreichende Faktenlage für die Integration in die Publikation geschaffen und die Qualität des Vorschlags für einen praxistauglichen Umgang nachgewiesen werden. Auch bedarf es zuerst einer Einordnung des internationalen Forschungsstands Lehmbau im Bezug zu den Anforderungen im Schweizer Brandschutz im Holzbau.
Dabei müssen wesentliche Grundlagen für eine Einbindung, insbesondere von Beplankungen und Bekleidungen in Kombination mit Holz noch erarbeitet bzw. näher untersucht und entsprechend aufbereitet werden. Mit dem derzeitigen Entwurf des Eurocode 5: Bemessung und Konstruktion von Holzbauten, Teil 1-2: Tragwerksbemessung für den Brandfall (FprEN 1995-1-2:2024) sind erste Ansätze für Lehmputz und eventuell Lehmplatten angelegt. Auf Basis von wegweisenden Forschungen und Brandversuchen wurden bereits erste modellierende Berechnungen durch Formeln erstellt, die dann systematisch erfasst und tabellarisch dargestellt werden können, um als zugängliches Planungswerkzeug zu dienen. Darüber hinaus geht es in diesem Vorhaben um Berechnungsgrundlagen für den Nachweis und Themen wie etwa Spezifikation der Materialeigenschaften, Festlegung geeigneter Baustoffe/Bauteile, Feuerwiderstandsnachweis der Bauteile mit Lehmprodukten. Dabei sind Brandversuche notwendig, deren Ausmass und Anzahl sich durch die Grundlagenerarbeitung ergibt, um die entsprechenden Nachweise für verschiedene Konstruktionen mit Holz und Lehmbaustoffen erbringen zu können.
Bauten sind unsere direkte Lebensumgebung. Wir wohnen oder arbeiten meist in Gebäuden. So sollte diese die Gesundheit unterstützen und der Umwelt nicht schaden. Wie mit Holz kann dies mit dem Baumaterial Lehm dauerhaft gewährleistet werden. In einer breiten Anwendung profitieren auch viele Menschen davon, dass Vorbehalte und Hemmnisse durch zugängliche Dokumentation und Regelwerke überwunden werden, ein attraktives Image und Vertrauen neu entsteht. Der Wandel im Bauwesen folgt auf diese Weise den gesellschaftlichen Schwerpunkten zur Umweltfreundlichkeit und zum Ressourcenbewusstsein.
Somit leistet das Projekt einen allgemeinen Beitrag zur Gleichstellung des Baustoffs Lehm zu anderen mineralischen Baustoffen in Regelwerken, hier im Brandschutz, und die Selbstverständlichkeit von Lehm als Baumaterial der Zukunft wird gefördert.
Die Zugänglichkeit und Einsatzmöglichkeiten von energiearmen Lehmbaustoffen werden verbessert. Holz erhält ein Schutzmaterial, das gleichrangige Nachhaltigkeit bietet. Im Gegenzug bekommt der Lehm im Brandschutz zukunftsweisend wieder einen Stellenwert, den er in früheren Zeiten als nicht brennbares Material und ungiftig brandschützender Baustoff für Holz schon vielerorts innehatte. Daneben wohnt dem Lehmbau ein unterschätztes soziales, partizipatives und kreatives Potenzial inne.
Projektbeschreibung
Für die Erreichung der Projektziele werden die folgenden drei Arbeitspakete gebildet:
Arbeitspaket 1: Grundlagenermittlung
Erste Recherchen zeigen, dass im Bereich Brandschutz mit Lehmbaustoffen eher wenig spezifische Grundlagenforschung vorhanden ist. Als Basis für die weiteren Forschungsarbeiten wird der aktuelle Kenntnisstand aus Normen, bereits durchgeführten Brandversuchen sowie Forschungsarbeiten zusammengetragen und systematisch ausgewertet. Die brandschutzrelevanten Materialeigenschaften sollen erfasst und aufgezeigt werden. Auch soll eine Marktübersicht (Angebotsseite) erstellt werden, welche Lehmbauprodukte derzeit auf dem Markt angeboten und verarbeitet werden. Damit wird im Projektteam das Verständnis für den Lehmbau geschaffen und die heutigen Möglichkeiten aufgezeigt. Anhand dieser Vorarbeit wird ersichtlich, welche Grundlagen bereits vorhanden und in welchen Bereichen weitere Untersuchungen bzw. Brandversuche erforderlich sind.
Zudem soll infolge der Variabilität von Lehm untersucht werden, welche Produkteigenschaften bzw. Zusammensetzungen von Lehmbaustoffen (z.B. Platten) für die Praxis relevant sind und einen grossen Anwendungsbereich abdecken können. Wichtig ist auch die Abschätzung künftiger Entwicklungen und Potentiale von Marktentwicklungen. Aus diesen Erkenntnissen können die für die weiteren Untersuchungen relevanten Materialspezifikationen an die Lehmbaustoffe (Rohdichte, Zusammensetzung, Fugenausbildung, usw.) abgeleitet werden. Allenfalls ist es zielführend, mögliche Produktkategorien zu definieren, damit die unterschiedlichen Materialeigenschaften und -zusammensetzungen einer Kategorie zugeordnet werden können und so eine breite Praxisanwendung von Lehmprodukten möglich wird. Diese Kategorien bilden die Grundlage für die weiteren Untersuchungen.
Nach Abschluss dieses Arbeitspaketes liegt eine Übersicht der verschiedenen Lehmbauprodukte mit Spezifikationen sowie ein zielführendes Versuchsprogramm für die Brandversuche (Arbeitspaket 3) vor.
Arbeitspaket 2: Projektkoordination
Das Projektteam ist interdisziplinär zusammengesetzt, um ein Maximum an Expertenwissen in den einzelnen Bereichen einzubringen. Dies erfordert eine optimale Projektkoordination zwischen den beteiligten Personen/Instituten. Den Beteiligten werden beim Projektstart klare Aufgaben und Verantwortlichkeiten zugeordnet. Durch einen regelmässigen Austausch und Abgleich der Ergebnisse unter den Beteiligten wird der Projektfortschritt laufend geprüft und falls erforderlich Massnahmen zur Justierung eingeleitet. Nebst den Beteiligten im Projektteam soll ergänzend ein Austausch mit weiteren Experten und Unternehmungen aus den Bereichen Brandschutz, Holzbau, Lehmbau usw. stattfinden. Dies stellt sicher, dass die Ressourcen im Projektteam so eingesetzt werden, dass die Ergebnisse ein möglichst breites Anwendungsgebiet erschliessen.
Arbeitspaket 3: Brandversuche
Anhand der bisherigen Recherche in der Literatur, Gesprächen mit Spezialisten aus den Bereichen Lehmbau und Holzbau sowie Absprachen zwischen den beteiligten Akteuren Lignum, ETH Zürich und IG Lehm wird derzeit von 8-12 Kleinbrandversuchen ausgegangen. Inhalt der Versuchsserie sind nach derzeitigem Wissensstand Lehmplatten als Beplankung, Lehmputze, Lehm als Beschwerung von Decken sowie zur Ausfachung von Holzständerwänden. Die Versuche werden im Herbst 2025 im Brandlabor der ETH Zürich (IBK) durchgeführt. Das genaue Versuchsprogramm kann jedoch erst nach Abschluss des Arbeitspaketes 1 definiert werden.
Die Brandversuche werden durch die ETH in Versuchsberichten dokumentiert. Auf Grundlage der Versuchsberichte wird ein Abschlussdokument erarbeitet, welches für die unterschiedlichen Lehmbaustoffe die Erkenntnisse und Angaben für die Ausarbeitung der Lignum-Dokumentation Brandschutz enthält.
Als Ergebnis dieses Arbeitspaketes liegen Berechnungswerte für verschiedene Lehmbaustoffe vor, damit eine Berechnung nach dem zukünftigen Bemessungsverfahren nach Eurocode 5: Bemessung und Konstruktion von Holzbauten, Teil 1-2: Tragwerksbemessung für den Brandfall (FprEN 1995-1-2:2024) möglich wird. Zudem werden die Anforderungen an die Lehmbaustoffe, Unterkonstruktion, Befestigung und Fugenausbildung als Grundlage für die Integration in die Lignum-Publikation definiert. Zur Plausibilisierung der Ergebnisse sind Vergleichsrechnungen an verschiedenen Konstruktionsaufbauten vorgesehen.
Nachfolgende Schritte: Integration in die Lignum-Dokumentation Brandschutz
Mit den gewonnenen Erkenntnissen aus den vorherigen Arbeitspaketen sollen im Rahmen der Überarbeitung der Lignum-Publikation 4.1 Bauteile in Holz – Decken, Wände und Bekleidungen mit Feuerwiderstand ergänzend Lehmbaustoffe tabelliert werden. Anhand der bestehenden Publikation aus dem Jahr 2015 wurden bei verschiedenen Bauteiltabellen bereits mögliche Zeilen mit Lehmbaustoffen eingefügt, um das Ausmass und die Machbarkeit zu prüfen. Die nachfolgende Abbildung gibt anhand einer Decken- und Wandtabelle eine Übersicht über das Potential und die Möglichkeiten zur Integration von Lehmbaustoffen in die Publikation, damit künftig eine einfache und praxistaugliche produktneutrale Nachweisführung möglich ist.
4. Projektorganisation
Das Projekt dient der intensiveren Kooperation mit der Holzbaubranche, insbesondere mit der Lignum, dem Dachverband der Schweizer Holzwirtschaft. Die Erarbeitung zum Lehmbau unterliegt der IG Lehm Fachverband Schweiz in enger Zusammenarbeit von internen Experten aus dem Lehmbau und Holzbau- und Brandschutzingenieuren. Der Austausch mit Forschungsinstituten und die Integration des aktuellen Forschungsstands sind ein selbstverständlicher Teil des Projekts.
Wissenstransfer der Ergebnisse
Das Wissen aus dieser Arbeit geht in erster Linie an die Lignum Holzwirtschaft Schweiz, damit die Berechnung und Integration von Lehmbaustoffen in die Lignum-Dokumentation Brandschutz möglich werden. Die Lignum-Publikation 4.1 Bauteile in Holz – Decken, Wände und Bekleidungen mit Feuerwiderstand wird von der Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen (VKF) als Stand der Technik-Papier freigegeben. Somit liegt eine verständliche Dokumentation zum Brandschutz mit Holz und Lehmbaustoffen vor, welche die Nutzung von Konstruktionen mit regenerativen Materialien über ein praktikables Planungswerkzeug ermöglicht und so der gesamten Planungs- und Baubranche zugänglich gemacht wird. Durch die Integration in die deutsch- und französischsprachige Lignum-Dokumentation Brandschutz ist eine grosse Reichweite gewährleistet und die Qualität der Grundlagen sichergestellt.
Projektfinanzierung
Aufgrund der begrenzten Eigenmittel der IG Lehm und der noch sehr kleinen Lehmbaubranche ist eine massgebliche finanzielle und impulsgebende Unterstützung aus öffentlichen Mitteln von entscheidender Bedeutung, um diese Weichen zu stellen. In Ergänzung zu der erhofften Förderung werden Stiftungen angefragt. Zusätzlich werden Mittel von Interessierten aus der Holzbaubranche und von Investoren angestrebt. Nichtsdestotrotz werden Ressourcen aus dem Netzwerk der Lehmschaffenden erbeten, um das Projekt auch als Engagement und für die Praxis zu stärken.
Stand 10.4.2025/ cl
Kontakt: brandschutz@iglehm.ch
// Quellenverzeichnis
• Liblik, J. (2023) Performance of timber structures protected by traditional plaster systems in fire, Doctoral Thesis, Tallinn University of Technology, Estonia [3]
• https://digikogu.taltech.ee/et/Download/dcb3d7ea-acf4-4420-a618-f8568cb3534e
• Liblik, J., Baumberger, A., Löffler Ch., Just, A. (2024) From tradition to future prospects. Clay as fire protection for timber, LEHM 2024, Weimar
• https://www.iglehm.ch/application/files/8817/2951/4899/lehm2024_b_liblik-baumberger-loeffler-just_de.pdf
• IG Lehm (2022) Standortpapier Lehmbau und Brandschutz mit Quellenkatalog, (online) https://www.iglehm.ch/verband/projekte/feuer-und-erde
• Lignum-Dokumentation Brandschutz, Ausgabe 2015, Nachdruck/Aktualisierung 2017,
• 4.1 Bauteile in Holz – Decken, Wände und Bekleidungen mit Feuerwiderstand, Holzwirtschaft Schweiz (Lignum)
• FprEN 1995-1-2:2024 Design of timber structures – Part 1-2: General – Structural Fire Design (letzter Entwurf in Überarbeitung)
• Tragende Stampflehmkonstruktion im Brandversuch (2022)
• https://nbau.yunv.de/2022/08/13/tragende-stampflehmkonstruktion-im-brandversuch/, Ernst & Sohn GmbH [2]
• DIN 18940: 2023-06 Tragendes Lehmsteinmauerwerk – Konstruktion, Bemessung und Ausführung [1]
• DIN 18942-1: 2018-12 Lehmbaustoffe und Lehmbauprodukte – Teil 1: Begriffe
• DIN 18942-100: 2018-12 Lehmbaustoffe und Lehmbauprodukte – Teil 100: Konformitätsnachweis
• DIN 18945:2018-12 Lehmsteine – Anforderungen, Prüfung und Kennzeichnung
• DIN 18946:2018-12 Lehmmauermörtel – Anforderungen, Prüfung und Kennzeichnung
• DIN 18947:2018-12 Lehmputzmörtel – Anforderungen, Prüfung und Kennzeichnung
• DIN 18948:2018-12 Lehmplatten – Anforderungen, Prüfung und Kennzeichnung
Standortpapier
Lehmbau und Brandschutz
Der Baustoff Lehm hat auf vielfältige Weise Potenzial, zur Reduzierung von grauer Energie und von Treibhausgasemissionen in der Baubranche beizutragen, wie angestrebt u.a. im SIA Positionspapier Klimaschutz, Klimaanpassung und Energie (1). In der Schweiz ist Lehm als Baumaterial in grossen Mengen und häufig lokal verfügbar. Speziell die Verwendung von Aushublehm bietet weiter grosse Chancen in Hinblick auf Zirkularitäten in der Bauwirtschaft. Während aber dem Lehm in vorindustrieller Zeit vielerorts Ruf und Rolle als feuerhemmendes Baumaterial zustanden (2, 3), ist er im aktuellen schweizerischen Brandschutznormwerk praktisch unerwähnt, was in der Praxis zumeist damit gleichbedeutend ist, dass der Baustoff bei brandschutzrelevanten Bauteilen nicht eingesetzt werden kann. Dadurch wird der Nichtbrennbarkeit des Materials zu wenig Rechnung getragen, und seine Verwendbarkeit bei Bauaufgaben jenseits von freistehenden Einfamilienhäusern und Gebäuden geringer Abmessung wird stark beeinträchtigt.

// 1. Inhalt und Zweck
Dieses Standortpapier entstand im Rahmen der Lancierung der Arbeitsgruppe Brandschutz im Lehmbau, welche sich zum Ziel gesetzt hat, die Möglichkeiten zur Verwendung von Lehmbaustoffen bei Bauteilen mit Brandschutzanforderungen sowie die zurzeit normbedingten Grenzen zu dokumentieren. Die Arbeitsgruppe erhofft sich darüber hinaus durch die Initialisierung von Forschungsprojekten das Einsatzspektrum gemäss Stand der Technik zu erweitern. Im Sinne einer Tour d'Horizon werden nachfolgend mit der Thematik verbundene Hintergründe und Herausforderungen beschrieben. Schwergewichtiger Bestandteil ist indes ein Quellenkatalog von aktuellen wissenschaftlichen Publikationen zum Thema Brandschutz im Lehmbau, von Prüfberichten sowie von relevanten Normen (insbesondere aus dem deutschsprachigen Raum).
// 2. Hintergrund
In den vergangen zwei bis drei Jahrzehnten haben Lehmbaustoffe in der Schweiz und in benachbarten Ländern eine Wiederentdeckung erfahren und werden vermehrt auch in mittleren bis grösseren Bauvorhaben eingesetzt. Dabei sind Anwendungen in Form einer Massivbauweise (z.B. Stampflehm und Lehmbausteine), Beplankung (Lehmbauplatten), Beschichtungen (Lehmputze) sowie Schütt-, Ausfach-, bzw. Giesstechniken zu unterscheiden. Während bei einigen Pionierbauten Lehm dabei das – teilweise auch tragende – Hauptbaumaterial darstellt, sind für die breite Anwendung Kombinationen von Lehm mit anderen Materialien wie Holz, Beton oder Stahl günstig. In der Schweiz hat gleichzeitig das Bauvolumen mit Holz bei mehrstöckigen Bauten seit der Aktualisierung der Brandschutzrichtlinien von 2015 massiv zugenommen. Dies geht einher mit einer Häufung von Tragwerken der Brandschutzverhaltensgruppe RF3 (statt RF1) und dem Bedarf an entsprechend erforderlichen nicht-brennbaren Bekleidungen und Ausfüllungen von Bauteilen. Weiter bedingen Holzbauten zur Verbesserung des Raumklimas und Reduzierung der Betriebsenergie im Gebäudeausbau häufig Materialien mit hoher thermischer Masse. Für beide Funktionen bietet der Baustoff Lehm interessante Eigenschaften.
// 3. Lehm in der schweizerischen Normgebung und Brandschutzpraxis
Die Regeln zum Bauen mit Lehm (4), 1994 durch eine Forschungsgruppe der SIA und der ETH Zürich veröffentlicht, stellten damals eine im deutschsprachigen Raum pionierhafte Systematisierung und Dokumentation gängiger Lehmbautechniken dar, sind aber für die heutige Planungspraxis wenig relevant und enthalten u.a. keine belastbaren Aussagen zum Feuerwiderstand von Lehm. In den Brandschutzvorschriften der VKF (kurz BSV, (5)) wie auch in der darauf aufbauenden Lignum Dokumentation Brandschutz (6) kommen Lehmbaustoffe nicht vor. Es kann vermutet werden, dass die BSV sowie vorgehende Normwerkzeuge in einer Zeit konzipiert wurden, als Lehm als bauwirtschaftlich bedeutungslos betrachtet wurde. Namentlich fehlt Lehm in der VKF Dokumentation Allgemein anerkannte Bauprodukte (7), wo Bauteilschichten aus vergleichbaren mineralischen Materialien wie Gips und Kalk abhängig von der Aufbaustärke eine festgelegte Brandschutzwirkung attestiert wird. Anders als die Fähigkeit zur Brandhemmung ist die Nicht-Brennbarkeit von Lehm in der Praxis in Übereinstimmung u.a. mit der deutschen DIN 4102-4 (8) anerkannt. Derzeit sind keine Lehmbauprodukte im VKF- Brandschutzregister eingetragen. Gemäss Angabe eines Schweizer Naturbaustoffhändlers läuft derzeit ein entsprechendes Aufnahmeverfahren für eine Lehmbauplatte. Des Weiteren existieren für einige Lehmprodukte Brandschutz-Prüfberichte anerkannter Laborinstitutionen. Eine Auflistung verfügbarer und den Autoren bekannter Prüfberichte ist im (dem Papier zugehörigen) Quellenkatalog vorhanden. Diese stammen vielfach aus Deutschland und Frankreich, und betreffen insbesondere Lehmbauplatten in Leichtbauwänden mit Holzständerkonstruktionen sowie Mauern aus stabilisierten oder nicht-stabilisierten Lehmbausteinen. Bei prestigereichen Projekten wurden kürzlich auch zum Brandwiderstand einer Gewölbedecke in Stampflehm sowie einer Stampflehmmauer Prüfberichte erstellt. Auf Prüfberichte anerkannter Institutionen kann prinzipiell auch in der Schweiz mit dem Ziel einer Einzelfallzulassung abgestellt werden. Durch die Eingrenzung auf ein spezifisches Produkt und auf einen festgelegten Bauteilaufbau ist die Anwendbarkeit indes selten. Ebenfalls sind Prüfberichte typischerweise nur mit Aufwand von den Produkteherstellern erhältlich – sofern ein Unternehmen diese überhaupt herauszugeben bereit ist. Die Bestellung solcher Prüfberichte für eigene Produkte und entsprechende Bauteilaufbauten ist typischerweise nur für grosse Hersteller oder im Rahmen von Projekten mit entsprechend grossem Budget finanziell tragbar. Jenseits der auf den Brandschutz bezogenen Normgebung sind in Deutschland in den vergangenen Jahren DIN-Normen zu Lehmplatten, -putzmörteln und -mauermörteln erarbeitet worden, welche Herstellern die Möglichkeit einer Produktezertifizierung geben. Die im deutschen Lehmbau als Stand der Technik gebräuchlichen Lehmbau Regeln (9) betreffen fortan insbesondere die (nicht zertifizierbaren) Anwendung von Aushublehm.
// 4. Handlungsbedarf
Für eine Vielzahl der an Planung und Bau beteiligten Architektinnen, Ingenieure und Ausführungsunternehmen ist das Wissen betreffend brandschutztechnischen Einsatzmöglichkeiten von Lehmprodukten heute schwer zugänglich und das Prozedere, um Lehmbaustoffe anstelle von Standardlösungen einzusetzen, ist in der Planungspraxis meist zu umständlich. Dies zeigen zahlreiche Gespräche, welche die Verfassenden mit ebensolchen Akteurinnen geführt haben. Um auf das wachsende Interesse am Einsatz von Lehmbautechniken bei Projekten mit Brandschutzanforderungen zu reagieren und um die entsprechenden Planungsprozesse zu unterstützen, ist somit auf der einen Seite eine Wissenskonsolidierung und -vermittlung nötig, im Sinne einer Dokumentation der heute zugelassenen Einsatzmöglichkeiten von Lehm. Insbesondere besteht indes Handlungsbedarf innerhalb der Normgebung an sich. Vorhandene Prüfberichte sowie Tests aus der Forschung (siehe Quellenkatalog, z.B. (10)) weisen auf hinreichend brandhemmende Qualitäten von Lehmbaustoffen für die Verwendung in Brandschutzbauteilen hin. Sie zeigen das Potenzial auf, dass diese Eigenschaften bzw. daraus abgeleitete brandschutzwirksame Bauteilaufbauten dereinst als Stand der Technik innerhalb der schweizerischen Normgebung anerkannt werden könnten. Dafür sind weitere Forschungsprojekte nötig, welche die Ergebnisse von vorhandenen Tests systematisieren und um weitere Versuche ergänzen.
// 5. Beispiele
Zwei Beispiele aktueller, speziell punkto Nachhaltigkeit vielzitierter Bauprojekte, illustrieren potenzielle Anwendungsmöglichkeiten von Lehm in brandschutzwirksamen Bauteilen, welche indes gemäss heutiger Normgebung trotz entsprechender Bemühung beteiligter Planer nicht zulässig waren.
Die Wohnüberbauung Bombasei in Nänikon, ein 2020 fertiggestellter Holzbau mit knapp 30 Wohneinheiten des Ateliers Werner Schmidt, besteht aus vorfabrizierten Raumelementen und Wandelementen, und einer mit Stroh gedämmten Fassade. Wohnungstrennwände und Fassade haben u.a. die Anforderung R60 zu erfüllen. Das Tragwerk besteht aus raumabschlussbildenden Brettsperrholzplatten. Während diese auf 30 Minuten zulässigen Abbrand bemessen sind, hat eine Überdeckung die zusätzlich benötigten 30 Minuten Brandwiderstand sicherzustellen, wofür Lehmputz auf einer Trägerschicht (z.B. Schilfrohrmatten) die bevorzugte Lösung der Planer darstellte. Da dessen Brandschutzwirkung indes nicht ausreichend belegt werden konnte, wurde das Tragwerk letzten Endes mit Gipsfaserplatten (GFP) beplankt.
Für die Aufstockung des Kopfbaus der Halle 118 auf dem Winterthurer Sulzerareal mit Ateliernutzung (fertiggestellt 2021 vom baubüro in situ) wurden zum Grossteil wiederverwendete Bauteile sowie die Materialien Holz, Stroh und Lehm eingesetzt. Die Fassade besteht aus mit Stroh ausgefachten vorgefertigten Holzelementen und einer vorgehängten Wetterschutzschicht aus Profilblech. Während raumseitig in diesem Fall eine Überdeckung des Strohs mit rund 5cm Lehmputz zum Erreichen des benötigten Brandwiderstands von der Brandschutzbehörde als ausreichend akzeptiert wurde, mussten die Fassadenelemente zur Hinterlüftungsebene hin mit GFP bekleidet werden. Diese konnten zwar neben der Brandschutzbekleidung gleichzeitig die Funktion der Aussteifung der Elemente bewerkstelligen, waren aber bauphysikalisch nicht unbedenklich (punkto Diffusionswiderstand) und die Planer hätten eine Beplankung mit Lehmplatten oder eine Überdeckung mit Lehmputz bevorzugt.
Den Beispielen ist gemein, dass das Herbeiziehen von Prüfberichten verwandter aber nicht identischer Bauteilaufbauten nicht zur Belegung der Brandschutzwirkung des gewünschten Aufbaus ausreichte, und dass das Prozedere für eine Einzelfallzulassung mittels Brandversuch an einem 1:1 Bauteilmuster finanziell nicht tragbar war.

// 6. Ausblick und Ziele
Während sich die Arbeitsgruppe derzeit im Aufbau befindet und die Ziele sowie dafür einzuschlagende Strategien nach Erarbeitung dieses Standortpapiers mit interessierten Parteien aus Forschung und Praxis zusammen formuliert bzw. geschärft werden sollen, können bereits einige Absichten sowie Eckpunkte genannt werden.
A - Vernetzung
Bei vielen Gesprächen mit Ingenieuren, Architektinnen sowie Unternehmern und Händlern stösst das Thema auf sehr grosses Interesse. Die Vernetzung der interessierten Akteure ist eine zentrale Herausforderung.
B - Initiierung von Forschungsprojekten
Um das zulässige Einsatzspektrum von Lehmbaustoffen gemäss anerkanntem Stand der Technik zu erweitern, sind brandhemmende Eigenschaften von Lehm in Forschungsprojekten nachzuweisen.
C - Förderung
Infolge grosser Fortschritte im Betrieb ist heute die Erstellung für den Grossteil des ökologischen Fussabdrucks neuer Gebäude verantwortlich. Die Verwendung von Lehm bei grossen Bauprojekten kann punkto Emissionen bei der Erstellung, grauer Energie, Ressourcenverfügbarkeit, Materialflüssen und Rückbaubarkeit entscheidend zur Erreichung von Nachhaltigkeitszielen beitragen. Angesichts dieses bestehenden öffentlichen Interesses und mittels Vernetzung sind Quellen für Fördergelder für Folgeprojekte zu suchen.
D - Die Erarbeitung einer Dokumentation
Sie soll die heutigen Möglichkeiten und Grenzen, sowie die benötigten Vorgehensweisen bei der Verwendung von Lehmbaustoffen für brandschutzrelevante Anwendungen aufzeigen und im Sinne einer praktischen Planungshilfe Planerinnen und Bauträgern zur Verfügung stehen. Sie soll ein tragfestes Argumentatorium im Dialog zwischen Architekten, Fachplanerinnen und Behörden schaffen.
E – Internationaler Austausch
Die Dichte an Prüfberichten sowie die im Vergleich zur Schweiz allgemein grössere Verbreitung von Lehmbauanwendungen in den Nachbarländern Deutschland und Frankreich sowie weiterer europäischer Länder lässt erahnen, dass bereits Erfahrungen im Umgang mit Brandschutzregelungen vorhanden sind. Hierzu soll ein Austausch mit den entsprechenden Akteuren (Verbänden und Experten) initiiert und die Rolle, sowie der potenzielle Beitrag des Schweizer Verbandes erörtert werden.
F – Langfristige Zielaspekte im Sinne einer Förderung von Lehmbaustoffen
Aus planungspraktischer Sicht wären folgende Qualitäten für zukünftige Einsatzmöglichkeiten von Lehmbaustoffen wünschenswert und sollen bei der Initiierung von Folgeprojekten nach Möglichkeiten als Fernziele Beachtung finden:
Einfache Werkzeuge für den Planungsalltag, insbesondere die Schnittstelle zu den Lignum Dokumentationen betreffend
(betr. Brandschutz) Weitgehende Gleichbehandlung von Lehmbauprodukten mit Produkten aus anderen Grundmaterialien, wie z.B. mit Platten aus Gipsfasern oder mit anderen mineralischen Verputzen. Dabei sollten sich lediglich aus Brandversuchen abgeleitete Anforderungen an die Dimensionierung unterscheiden
Produkteunabhängigkeit der Normgebung
(damit verbunden) Berücksichtigung von Produkten kleiner und lokaler Produzenten, für welche aufwändige produktespezifische Zulassungsverfahren nicht erschwinglich sind
Berücksichtigung von Aushublehm. (Hierfür könnten die Zulassungsbedingungen für – gleichfalls schwer normierbare – tragende Stützen aus Baumstämmen ein Vorbild sein)
G - Ausblick
Termine für Etappenziele werden zusammen mit interessierten Beteiligten von Folgeprojekten erarbeitet. Als entfernte Rahmentermine, auf welche Bezug genommen werden soll, sind die für die Jahre 2025 angekündigte nächste Revision der BSV vom VKF, sowie die für ca. 2026 erwartete Aktualisierung der Lignum Dokumentation zu nennen.
// Die Arbeitsgruppe Brandschutz im Lehmbau
Die Arbeitsgruppe besteht derzeit aus Architektinnen, Fachplanern und Ausführenden mit Interesse am Bauen mit Lehm. Den Anstoss zur Lancierung gaben Erfahrungen aus eigenen Projekten der Mitglieder, sowie Voten von Mitgliedern der IG Lehm. Die Gruppe befindet sich im Aufbau, Interessierte können über brandschutz@iglehm.ch Kontakt aufnehmen.
// Die IG Lehm
Die IG Lehm ist der Schweizer Lehmfachverband. Sie ist als Verein organisiert und steht Lehmbaufachleuten und -interessierten aus Planung, Ausführung und Baustoffvertrieb offen.
Stand 22.9.2022
Wir danken den beratenden Ingenieuren von B3, Christoph Angehrn und Ivan Brühwiler für die fachliche Unterstützung in dieser Anfangsphase.
IG Lehm Arbeitsgruppe Brandschutz im Lehmbau
Adrian Baumberger, Christiane Löffler, Christoph Merk, Doris Müller, Hansjakob Eggenberger

// Quellenverzeichnis
(1) SIA (2020) 'Positionspapier KLIMASCHUTZ, KLIMAANPASSUNG UND ENERGIE' [online] 17.7.2022 https://www.sia.ch/fileadmin/Positionspapier_Energie_dt_FINAL.pdf
(2) Blaschek J. A. (2016) 'Lehmspuren – Österreichs Lehmbaugeschichte und ihr Mehrwert für eine nachhaltige Baupraxis' > erhältlich via IG Lehm
(3) Pestalozzi M. (2018) 'Die Pisé-Häuser von Fislisbach' [online] 17.7.2022
https://www.swiss-architects.com/de/architecture-news/meldungen/die-pise-haeuser-von-fislisbach
(4) SIA (1994) 'D 0111 Regeln zum Bauen mit Lehm' > gem. Quellenkatalog
(5) VKF Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen 'Brandschutzvorschriften' [online] 17.7.2022
https://www.bsvonline.ch/de/
(6) Lignum, Holzwirtschaft Schweiz 'Lignum-Dokumentation Brandschutz' [online] 17.7.2022
https://www.lignum.ch/holz_a_z/brandschutz/
(7) VKF Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen (2017) 'Allgemein anerkannte Bauprodukte'
> gem. Quellenkatalog
(8) DIN (2016) 'DIN 4102-4 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen - Teil 4'
> gem. Quellenkatalog
(9) Dachverband Lehm e.V. (2009) 'Lehmbauregeln' > gem. Quellenkatalog
(10) Liblik J., Just A, Küppers J. (2020) 'Eigenschaften von Lehmputzen für den Brandschutz von Holzkonstruktionen' > gem. Quellenkatalog